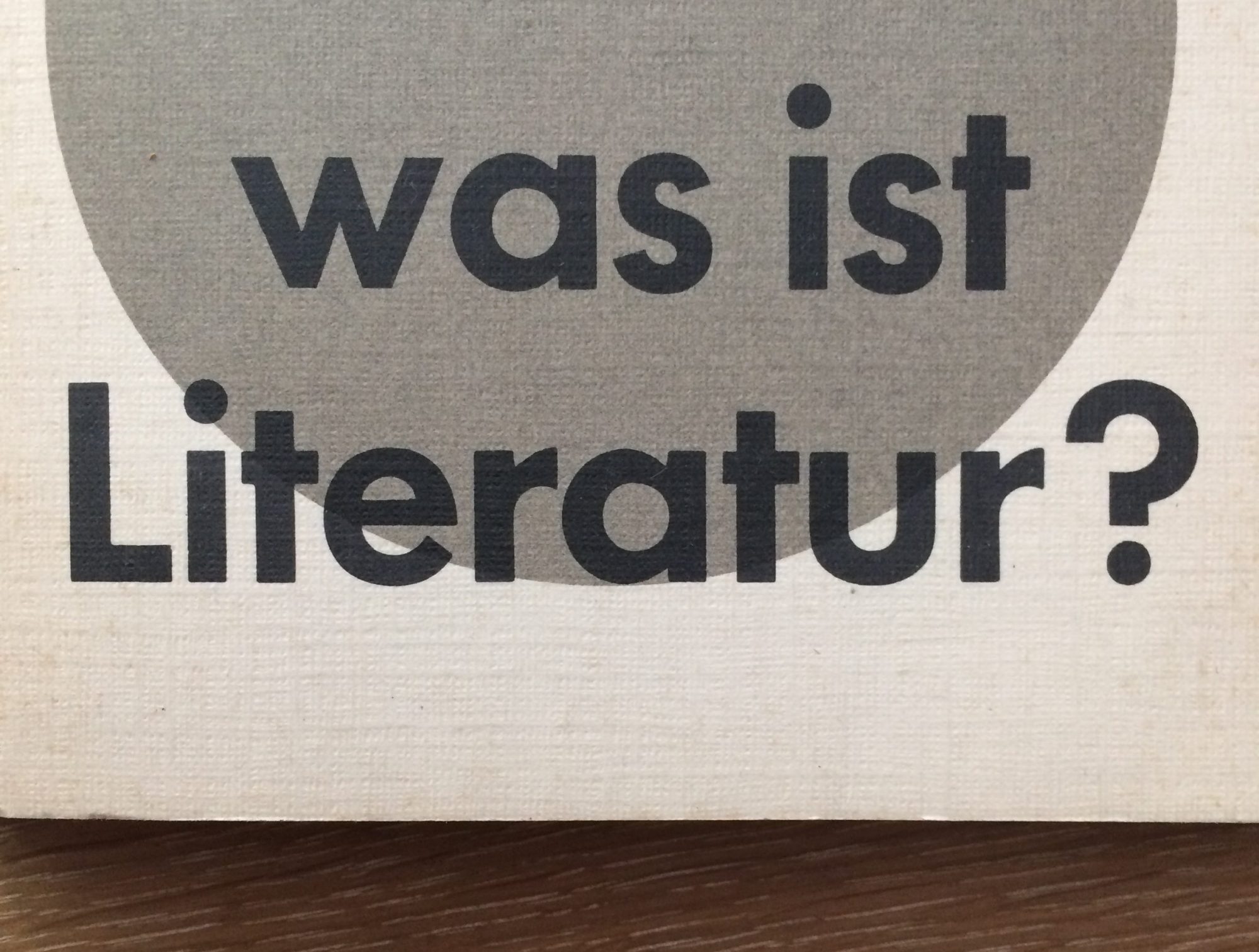Mathilda, Birte und Olivia kennen sich seit Schulzeiten. Jetzt treffen sie in einer Jagdhütte im Wald wieder zusammen. Und es geschehen seltsame Dinge, bei denen sich die Erscheinungen in der Natur und persönliche Erfahrungen mit Mathildas Visionen und Tagebuchaufzeichnungen vermischen. Was liegt diesem eigenartigen Geschehen zugrunde? Ein wildes Motto hat Marion Poschmann ihrem neuen Roman vorangestellt. Es ist ein Zitat aus dem berühmten Gedicht „Am Turme“ von Annette von Droste-Hülshoff. „Und darf nur heimlich lösen mein Haar, Und lassen es flattern im Winde!“ Drostes Gedicht beschreibt die Sehnsucht seiner Sprecherin, die, „gleich einem artigen Kinde“ an ihre Rolle als domestizierte Frau gebunden, aus dieser auszuscheren versucht.
Eine gezähmte Frau ist auch Mathilda, Lehrerin und Hauptfigur von „Chor der Erinnyen“. Ihr Mann hat sie gerade unvermittelt verlassen. Er ist, wie man aus Poschmanns vorangegangenem Roman „Die Kieferninseln“ weiß, unterwegs in Japan. Ihre Mutter, eine strenge Frau, hält Mathilda noch immer unter ihrer Fuchtel. Während Mathilda weiter ihrem genau geregelten Leben im wohlgestalteten Ambiente nachgeht und das Verschwinden ihres Mannes verschleiern möchte, geschehen um sie herum merkwürdige Dinge. Manche haben mit ihrem Schreiben, ihrer Schrift zu tun:
„Sie begann mit einem ersten Gewölle, ließ sich Zeit mit den Linien, schlang sie sorgsam übereinander, immer dichter.“
Das Schreiben als Versuch, Bedeutung herzustellen, ist der Lehrerin vertraut. Sie schreibt in der Klasse Ziffern und Wurzeln, Noten, Bass- und Violinschlüssel ebenso an die Tafel schreibt, Integrale, Graphen und Parabeln. Sie verirrt sich aber, wenn es darum geht, in ihrer Handschrift verobjektivierbare Zeichen in die Kladde zu schreiben. Die Kringel und Krakel wirken wie das ausgespiene, unverdauliche Gewölle einer Eule. Mathildas Inneres verirrt sich quasi auf dem Weg in die Welt. Doch nicht nur Mathildas Schrift entzieht sich der Bedeutung, löst sich auf. Tassen fallen zu Boden, ein Wald beginnt zu brennen. Die Natur gerät in Aufruhr. Gegen Ende des Romans zieht ein furioser Sturm auf:
„Erst jetzt hörte sie einen ohrenbetäubenden Wind, ein auftrumpfend machtvolles Wehen, Sturmesgewalt. Sie ging ein langgezogenes Brombeergebüsch entlang, es wehte stetig an diesem Gebüsch vorüber, die Brombeerzweige schwankten, ein einzelnes rotes Ahornblatt taumelte vor ihr her.“
Und während Mathilda in den Sturm hineingeht, verwandelt sich das Blatt:
„Jetzt vermehrte es sich zu einer Laubwolke, rot, rot, rot, rot, sie sah gefächerte Schirme vor sich, Baldachine, Blätterdächer, sie sah sich selbst, wie sie durch diese Blätterwolken schritt, langsam mit Würde, der Macht des Alleinseins durch rote, blutrote Wolken von der Farbe innerer Organe, es war ein Zustand, an den sie sich jetzt plötzlich wieder erinnern konnte.“
Das „Wandeln des Blattes“ im Sturm gleicht dem Ausbrechen aus dem System einer begrifflichen Schrift. Die merkwürdige Korrespondenz zwischen Mathildas innerem Erleben und einer entfesselten Natur führen ins Epizentrum dieses anspielungsreichen und extrem dicht gebauten Romans mit seinen Episoden, Nebensträngen, Verweisen. Auf der Bühne der Natur kann geschehen, was Mathilda verdrängt, unterdrückt, beherrscht und kleinhält – und kleinzuhalten gelernt hat.
„Chor der Erinnyen“ erzählt davon, wie in der Geschichte des Abendlands, vor allem aber seit der Aufklärung das zurückgedrängt worden ist, was bei dem Schweizer Psychoanalytiker Carl Gustav Jung Anima genannt wird. Jung unterschied in seiner Beschreibung der menschlichen Seele die Archetypen Animus und Anima. Während der Animus für die männliche Natur steht, für Geist und Gedächtnis, steht Anima für Wind, Atem und Seele. Jung sieht in jedem Menschen beide Anteile angelegt, beide Anteile können gute und schlechte Wirkungen entfalten.
Keineswegs geht es in „Chor der Erinnyen“ um eine simplifizierende Darstellung der Geschlechterverhältnisse nach dem Motto „Böse Männer – Arme Frauen“. Die Frage, um die sich der Roman weitaus stärker, zeitweise amüsant, dann wieder verstörend, aber immer stupend klug und motivisch dicht verwoben verdient macht, lautet eben nicht: Wie wurden und werden Frauen benachteiligt? Sie lautet dagegen: Wie ließe sich anders vermitteln zwischen männlichem und weiblichem Prinzip, das nicht zwingend an ein biologisches Geschlecht gekoppelt ist? Wie ließe sich anders vermitteln zwischen Chaos und Ordnung, zwischen Lustgewinn und Triebverzicht, wie sich anders sprechen über das, was in der Geschichte des Abendlandes dem Animus zum Opfer gefallen ist?
Nach der Lektüre ist auch das Motto des Romans präziser deutbar, in dem das Wort „heimlich“ fällt: „Chor der Erinnyen“ fragt von vielen Seiten aus nach dem Unheimlichen in all seinen Gestalten, nach dem offen Ungeordneten. Es geht zuvorderst von Mathilda aus, aber auch von ihren beiden Freundinnen Birte und Olivia, mit denen Mathilda, den Hexen in Shakespeares Macbeth vergleichbar, im Wald zusammenkommt. Das Unheimliche wird von drei Wesen verkörpert, ist und bleibt in der Welt. Es manifestiert sich im Roman am ausdrücklichsten in dessen chorischen Passagen, in denen die Erinnyen, die drei antiken Rachegöttinnen, das Geschehen kommentieren. Wie „Chor der Erinnyen“ das Unheimliche als Ausdruck von gestörten Balancen in seinen äußeren und inneren Ausformungen beschreibt, ist meisterhaft. Einmal mehr zeugt der Roman vom Ausnahmekönnen seiner Autorin.
https://www.deutschlandfunk.de/marion-poschmann-chor-der-erinnyen-dlf-fddfed6a-100.html