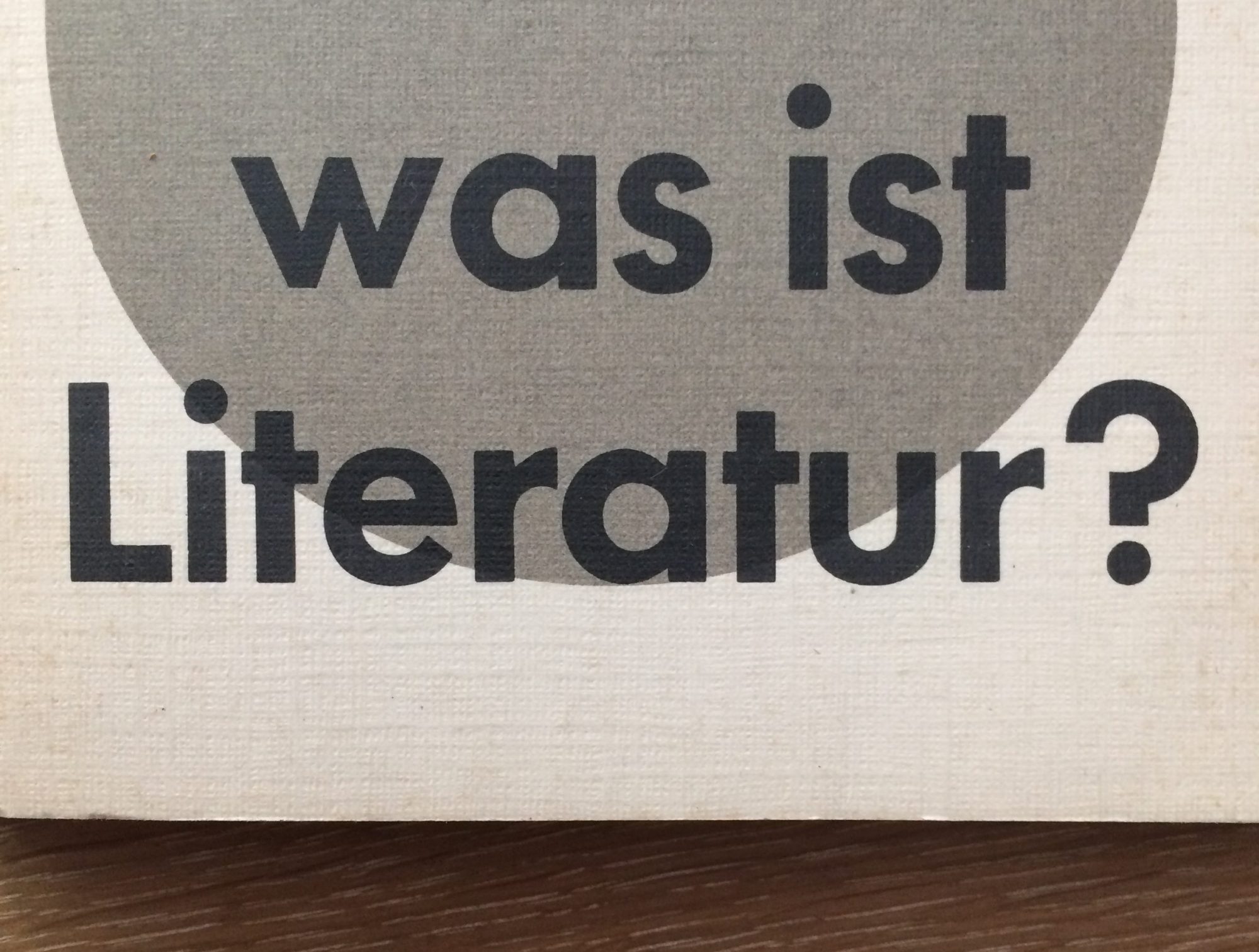Zu den wichtigsten Filmen, die ich als Schülerin gesehen habe, zählt Margarethe von Trottas „Rosa Luxemburg“. Als von Trotta an Adornos Geburtstag am 11. September 2018 in der Frankfurter Paulskirche mit dem Theodor-W.-Adorno-Preis ausgezeichnet wurde, zeigte man im Rahmen der Preisverleihung, — ich meine mich zu erinnern, dass es auf den Wunsch der Regisseurin geschah — , die Szene, die den Mord an Rosa Luxemburg zeigt. Rosa Luxemburg, grandios glaubwürdig bis ins leichte Hinken hinein verkörpert — ja, verkörpert!! — von Barbara Sukowa, spricht zuvor in einem Zimmer des Wilmersdorfer Hotels Eden, in dem sie gefangen gehalten wird, mit dem jungen Wächter. Sie fragt ihn nach seiner Herkunft, nach seiner Familie. Der junge Mann zögert beim Antworten.
Sie sagt so etwas wie „Du darfst nicht mit mir sprechen, nicht wahr?“ Der junge Mann wirkt peinlich berührt. Ein intimer und empathischer Moment, den von Trotta glaubhaft imaginiert und Sukowa brillant spielt, ehe die Kavalleristen ins Zimmer platzen, Rosa Luxemburg durch die Flure des Hotels führen, ehe man ihr mit einem Gewehrkolben auf den Hinterkopf schlägt, sie in einen bereit stehenden Wagen wirft. Ehe sie mutmaßlich von dem Offizier Hermann Souchon erschossen und in den Landwehrkanal geworfen wird.
Als ich den Ausschnitt im September bei der Preisverleihung wiedergesehen habe, erinnerte ich mich an das erste Sehen des Films, wahrscheinlich 1985 oder 1986, in der immer mittwochs laufenden Filmauslese im Kino-Center-Selb im Kinosaal 1, auf dessen Leinwand sich ziemlich in der Mitte ein fast handtellergroßer Fleck befand, um dem ich zu Beginn eines Films immer ziemlich bemüht herumschauen musste, ehe mich der Film in Bann zog. Manchmal klappte es gar nicht, dann war der Film eindeutig schlecht, manchmal vergaß ich den Fleck praktisch sofort. So auch bei „Rosa Luxemburg“.
Ich hatte nichts von der „Roten Rosa“ gewusst und las anschließend Luxemburgs Briefe, ich las Frederik Hetmanns „Rosa L.“. Ich würde heute gerne Ernst Pipers Biografie „Rosa Luxemburg“ lesen, die gestern in „Andruck“ im Deutschlandfunk besprochen wurde, ob ich es bei der vielen Arbeit auf meinem Tisch einrichten kann, weiß ich grade nicht.
Gerade in ihren Briefen erinnerte mich die Revolutionärin, die in Zürich unter anderem Zoologie studiert hatte, mit ihrer Liebe zu gefiederten Kreaturen an meine Großmutter, die in ihrem Haus am Waldrand und mit Fensterausblicken auf den riesigen, von meinem Großvater angelegten Obstgarten so gerne die Vögel anlockte: Meisen, Amseln, aber auch Eichelhäher, jene schönen Vögel mit den blauschwarz gestreiften Federpartien, die mir meine Großmutter zuerst unter dem schönen Oberpfälzer Wort „Nussgackl“ vorstellte. Einige von ihnen kamen regelmäßig in den Kirschbaum vorm Wohnzimmerfenster, viele zu den Vogelhäuschen vor den Fenstern des Hauses. Wenn ich bei meiner Großmutter zu Besuch war, näherten wir uns manchmal in einem der Zimmer ganz langsam diesen Häuschen in der Hoffnung, den Vögel dabei zuzusehen, wie sie die Sonnenblumenkerne zerknackten. Manchmal hatten wir Glück. Mir kam es als Kind immer so vor, als kenne meine Großmutter jeden einzelnen dieser Vögel persönlich, und wer weiß, vielleicht war es ja so.
Die Zierlichkeit der heranflatternden Meisen wurde von meiner Großmutter gerne mittels des Diminutivs unterstrichen: sie sprach von den „Meiserln“, manchmal auch von den „Meislein“, letzteres spannte für mich dann einer Brücke direkt zu meiner Vorstellung von Gott, den ich mir als Kind in Verbindung mit diesem Wort immer als einen lieben, einen liebenden Gott vorstellte, jenen Gott aus dem Kinderlied „Weißt du wieviel Sternlein stehen“, in dem ja auch alle angesprochenen Wesen und Phänomene zärtlich mit Diminutiven benannt sind und Gott persönlich bekannt.
Bei Rosa Luxemburg heißt es in einem Brief vom 2. Mai 1917 an ihre Freundin Sonja Liebknecht aus der Haft in der Festung Wronke:
„Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin kein richtiger Mensch, sondern auch irgendein Vogel oder ein anderes Tier in Menschengestalt. Innerlich fühle ich mich in so einem Stückchen Garten wie hier oder im Feld unter Hummeln und Gras viel mehr in meiner Heimat als – auf einem Parteitag. Ihnen kann ich ja wohl das alles sagen: Sie werden nicht gleich Verrat am Sozialismus wittern. Sie wissen, ich werde trotzdem hoffentlich auf dem Posten sterben: in einer Straßenschlacht oder im Zuchthaus. Aber mein innerstes Ich gehört mehr meinen Kohlmeisen als den ‚Genossen‘.“
Diese freundliche Stimme einer das Lebendige liebenden Revolutionärin fällt mir also womöglich auch aufgrund dieser kindlichen Prägung ein, wenn ich den Namen Rosa Luxemburg höre. Sie brachte mir die Revolutionärin näher. Wenn Sukowa in von Trottas Film oder Piper in seiner Biografie oder auch Elke Schmitter in ihrem lesenswerten und aktualisierenden, essayistischen Gedenkartikel „Auch eine Kassandra“ im SPIEGEL vom 5. Januar 2019 daran erinnern, dass Luxemburg aufgrund einer Knochentuberkulosediagnose zum Liegen in Gips gezwungen mit einer Gehbehinderung, fällt mir auch Frida Kahlo ein, wie Luxemburg eine zeitweise zum Stillhalten verdammte, nachher umso leidenschaftlichere Frau, die sich enthusiastisch ihrer Arbeit gewidmet und sich, glaubt man biographischen Berichten, ebenso offen, aufmerksam und froh den Menschen um sich herum gewidmet hat, wie Rosa Luxemburg.
Das Gedenken an die Ermordung Rosa Luxemburgs heute vor hundert Jahren, ruft mir gleich also mehrere enthusiastische und empathische Frauen ins Gedächtnis, die sich eine bessere Welt wünschten und mit ihren je eigenen Mitteln danach trachteten.
P.S.: Elke Schmitters Artikel im „SPIEGEL“ endet mit Paul Celans Gedicht „Eis, Eden“ über den Mord an Rosa Luxemburg. Wenn ich das Gedicht lese, wird mir auch bewusst, dass man sich in der Kunst der Geschichte, ihren Helden und Opfern eben würdiger oder unwürdiger nähern kann. Und ich verlasse mich getrost auf das Urteil derer, die mir dieser sagen, dass man sich manche Lektüren mit historischen Reminiszenzen wohl besser spart, um mehr Lesezeit übrig zu haben für das, was zu lesen sich mehr lohnt.