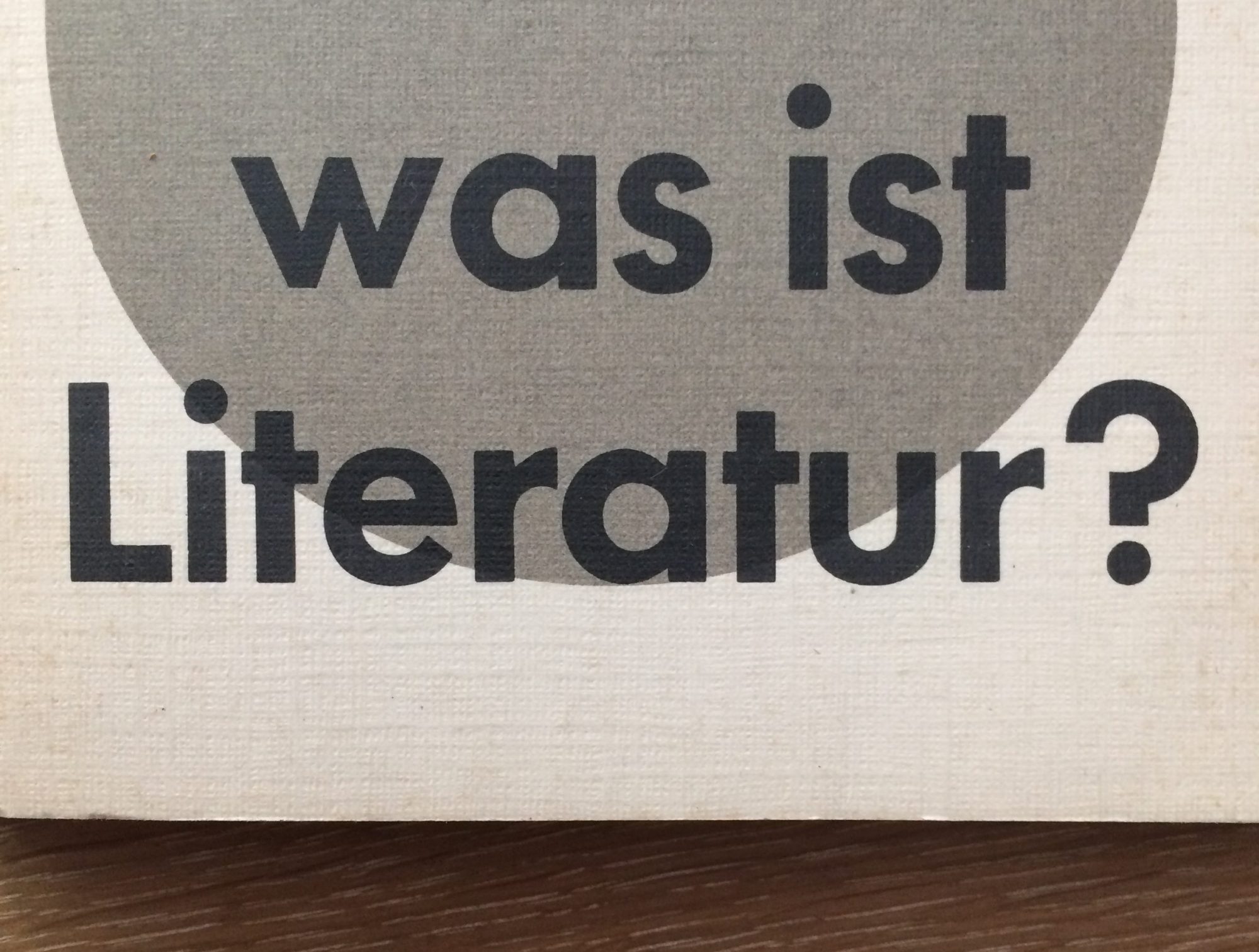Einen „Erkunder der Liebe“ hat man den 1948 geborenen Bodo Kirchhoff genannt. Es sind die Spielarten von Liebe und Eros, die der Autor in allen Variationen in all seinen Romanen und Novellen von Beginn an durchdekliniert. Auch im neuen Roman stehen Liebe, Eros und Sehnsucht erneut im Zentrum der Handlung. Ferragosto steht bevor, der in Italien so wichtige Feiertag Mariä Himmelfahrt. Er fällt zusammen mit dem 75. Geburtstag von Louis Arthur Schongauer, der mit einer Menge quälender Erinnerungen in seinem Haus an einem der Hänge des Gardasees lebt. Seine Frau Magda, Tierfotografin, ist beim Schwimmen ertrunken. Schongauer hat sich nach diesem Tod mit der Hündin Ascha zurückgezogen.
„Seit er sein Leben mit einem Tier teilt, denkt Schongauer manchmal daran, dass er gern als dieses Tier auf die Welt gekommen wäre, nur mit dem Gedächtnis für Gut oder Ungut, Freund oder Feind und ohne Wissen um die Zeit.“
Herr und Hund, so beginnt es. Doch rasch wird die Einsamkeitszweisamkeit von der jungen Reisebloggerin Frida gestört. Sie hat sich mit ihrem Wohnmobil vor Schongauers Haus heillos verfahren und lockt Schongauer als erste aus seinen Gedanken, ehe am nächsten Tag auch die Autorin Almut Stein ankommt. Sie hat sich angemeldet, um Schongauer zu porträtieren und zu interviewen. Die männliche Askese und Einsamkeit werden, so stellt sich also heraus, bedroht von Verlockungen und Anfechtungen, insbesondere weiblicher.
Um dies zu illustrieren, fährt Kirchhoff wuchtige künstlerische und literarische Referenzen auf: Martin Schongauers „Die Versuchung des Heiligen Antonius“. Der Stich zeigt den Eremiten umgeben von grausigen Zwitter- und Frauengestalten, die Antonius zu zerreißen drohen. Der Stich ist, wie man anfangs erfährt, in der Wohnung des nachgeborenen Namensvetters Schongauer, so aufgehängt,
„dass man ihn auf dem Klo sitzend vor sich hat, dazu griffbereit das gleichnamige Buch von Flaubert, wie andere dieses Örtchen mit einem Comic bereichern“.
Flauberts Roman „Die Versuchung des Heiligen Antonius“ ist die weltliterarische Variante der Bedrängnis des Mannes durch das Weibliche: Bei Kirchhoff sind die Attacken zwar nicht unbedingt teuflischer Art, aber in der witzig gemeinten Gleichsetzung von Flaubert mit einem Comic bricht sich bereits die Art der Prätention Bahn, die in diesem Roman immer wieder aufscheint in Sätzen, die sich nur unter Ächzen ertragen lassen.
„Männer sind nur selten keine Männer mehr. So, als wären sie im Frauenkörper auf die Welt gekommen oder als zweite Geige.“
ugegeben, hier spricht die vom Arztgatten betrogene Autorin und Journalistin Almut, in die Schongauer sich im Laufe des Gesprächs verlieben wird. Sie hat eine ziemliche Wut auf Männer, sagt, sie kenne keinen Mann, für den es kein Gewinn an sich sei, nicht als Frau auf die Welt gekommen zu sein. Das passt in gewisser Weise zu Schongauers Leben ohne Frauen. Aber reden Frauen tatsächlich so?
Das zweite große Erkundungsfeld des Romans ist die Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Tier, nach dem Wesen des Menschen als intelligibles Tier, als zoon und animal, dessen Verortung im Tierreich aber nicht hinreicht, um ihn zu beschreiben, der Mensch, der sich gelegentlich nach einer Tiernatur sehnt. Doch auch hier geht es zeitweilig zwiespältig zu, wenn der projektive Blick sich Bahn bricht, in der Hündin zu deutlich aufscheint, was doch Schongauer fehlt.
„Tausende Male war das so, ein Wedeln als Signal für alles Verlässliche, das von ihm ausgeht, in so blindem Vertrauen, dass er in dem Moment auf die Knie fiel, um mit ihr auf gleicher Höhe zu sein.“
Konstruiert wirkt, dass Schongauers ertrunkene Frau Tierfotografin war, ihr Berufsleben lang ihrer Faszination für Tiere Ausdruck gab, kurz vor ihrem Tod noch ein ertrunkenes Pferd am Strand abgelichtet hat. Überhaupt die Dramaturgie: Wie wahrscheinlich ist es, dass zwei Frauen zugleich bei einem einsamen alten Schauspieler aufkreuzen? Wie nahe liegt es heute noch, eine Freiberuflerin im kostspieligen Lancia Cabrio nach Italien fahren zu lassen, um dort tagelang einen halbvergessenen Schauspieler zu befragen? Wie nachvollziehbar ist es, das Interview auf dessen Boot auf dem Gardasee zu verlagern, wo die zwei nach dem Schwimmen lediglich in Handtücher gewickelt bei Salami und Wein ihr begonnenes Gespräch fortsetzen? Wie glaubwürdig ist, dass Almuts Arztgatte Schongauers Herzschwäche durchs Telefon hören kann?
Kaum anders bestellt ist es um die Symbolik. Der Sturm, den die Figuren in Schongauers Haus erleben, zerdrückt auch das altersschwache Boot und deutet darauf hin, wie es mit Schongauers und Almuts Verliebtheit weitergeht. Sie endet. Schongauer schließt mit allem ab, wird seine Hündin der Obhut einer anderen Frau übergeben. Es hilft bei der Lektüre von „Seit er sein Leben mit einem Tier teilt“ wenig, dass es passagenweise auf Martin Walsers „Ein fliehendes Pferd“ anspielt. Es hilft wenig, sich zu erinnern, dass man jahrelang Bodo Kirchhoffs Bücher über die abgründigen Spielarten der Liebe neugierig und häufig auch gern mitgelesen hat. Dieser Roman ist bis in die bizarre Beschreibung von Frauensandalen hinein zwiespältig:
„Schongauer sieht auf die Füße der Stein in offenen, libellenhaften Schuhen, Füße mit Zehen wie Orgelpfeifen, die Nägel perlmutthell.“
Man kennt diese Sandalen bereits aus Kirchhoffs buchpreisgekrönter Novelle „Widerfahrnis“:
„Sie stand dort in Sandalen, die aber nichts Gesundheitliches hatten, sondern vielmehr etwas nervös Libellenhaftes.“
Wie abgedichtet gegen sich selbst spricht der Protagonist dieses Romans, irgendwann regt sich beim Lesen der Wunsch, die Frauen müssten nicht noch einmal schuld sein, in diesem Fall daran, das Erzählen des schweigenden alten Schauspielers durch ihr Auftauchen, ob nun in Turnschuhen oder libellenhaften Sandalen, wieder in Gang gesetzt zu haben.